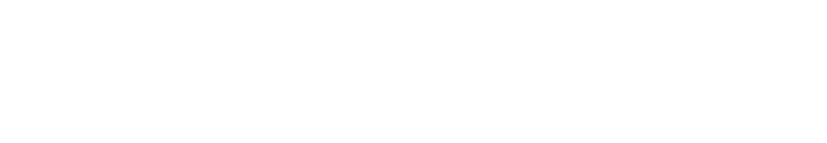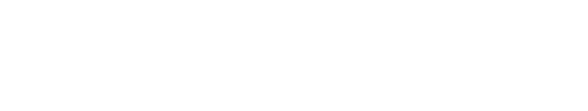ANNEMARIE SCHIMMEL
Meine Barmherzigkeit ist größer als Mein Zorn. Gedanken zum islamischen Gottesbild
Der islamische Gottesbegriff scheint überaus einfach zu sein. Man wird Muslim durch das Aussprechen der Formel: "Ich bezeuge, daß es keine Gottheit als Gott (Allah) gibt, und daß Muhammad Sein Gesandter ist."
Die zentrale Stellung des Eingottglaubens für den Muslim wird noch genauer definiert in Sura 112, die man als das logische Schlußstück des Korans ansehen kann: "Sprich: Gott ist einer, Gott ist der Ewige, Er hat nicht gezeugt und ist nicht gezeugt, und Ihm gleich ist keiner."
Diese Sura, die wohl zunächst gegen die heidnischen Mekkaner mit ihrer Vielzahl von Gottheiten gerichtet war, wurde später als Ausdruck der Ablehnung der christlichen Trinitäts- und Inkarnationslehre interpretiert. Doch so einfach der islamische Monotheismus zu sein scheint, haben die Gläubigen Gott doch immer anders umschrieben, immer neu mit Worten und Gedanken umkreist, so sehr die Tradition sie auch warnen mochte, nicht über das Wesen Gottes zu grübeln, sondern über Seine Werke.
Der Koran selbst umgibt Gott mit zahlreichen Namen, die Seine Macht und Seine Gnade, Seine Stärke und Seine Milde, Sein Werk als Schöpfer, Erhalter und Herrn des Jüngsten Gerichtes andeuten, und die Kette der sogenannten Schönsten Namen (Sura 7:180), die aus 99 Namen besteht, hat den Muslimen immer dazu gedient, sich dem unnahbaren Gott, der der Erste und der Letzte, der Äußere und der Innere ist (Sura 57:2), zu nähern, denn Er ist ja dem Menschen auch "näher als seine Halsschlagader" (Sura 50:16). Aber im Grunde kann man von Ihm nur sagen: "Er ist" - alle Prädikationen sind vom mangelhaften menschlichen Verstand erfundene vergängliche Gebilde. Und doch, für den Einsichtigen gilt das Wort: "Nichts ist, das nicht Sein Lob verkünde" (Sura 17:44).
I.
Die Scholastiker des Islams versuchten, den All-Gewaltigen in das Netz theologischer Bestimmungen zu bannen, und eine Dogmatik wie die Sanusiyya, die seit dem 15. Jahrhundert einen wichtigen Teil der theologischen Ausbildung darstellt, versucht Gott mit 41 Definitionen zu schildern. Ihm kommen notwendigerweise 20 Eigenschaften zu, deren Gegensätze unmöglich sind:
Was Ihm notwendig zukommt, sind 20 Eigenschaften: 1. Existenz; 2. Uranfänglichkeit; 3. Dauer; 4. Verschiedenheit vom Gewordenen; 5. Bestehen durch sich selbst; 6. Einzigkeit; ferner 7. Macht; 8. Wille; 9. Wissen; 10. Leben; 11. Hören; 12. Sehen; 13. die Rede; dazu sieben akzidentielle Eigenschaften: 14. Sein Mächtigsein; 15. Wollendsein; 16. Wissendsein; 17. Lebendsein; 18. Hörendsein; 19. Sehendsein; 20. Redendsein.
Zwanzig Eigenschaften sind für ihn unmöglich, nämlich Nicht-Existenz usw.
Möglich ist in betreff Gottes das Tun oder Lassen jedes Möglichen. So wird der lebendige, aktive Gott des Korans in ein - im einzelnen noch genauer ausgearbeitetes - Netz von Begriffen eingeschlossen.
II.
In der Mystik wird Er wiederum anders gesehen: Die frühen Mystiker nahmen die Feststellung, daß es keinen Gott außer Ihm gäbe, ganz wörtlich und formulierten, im Einklang mit der Orthodoxie, zunächst, daß es "keinen Handelnden außer Ihm" geben könne: Alles, was in der Welt geschieht, entspringt unmittelbar der Aktivität des Allmächtigen, und weder fällt ein Blatt vom Baume noch kann der Mensch ein Wort äußern, außer wenn Gott es will. Auch das menschliche Gebet ist immer eine Antwort auf Gottes Anrede.
Diese Rolle Gottes als dessen, von dem allein Wort und Handlungen ausgehen, kann abgeleitet werden aus dem Konzept des Urvertrages: Sura 7:172 berichtet, wie der Schöpfer in der Urzeit die noch nicht existierende Menschheit aus den Lenden Adams zog und anredete: "a-lastu bi-rabbikum, Bin Ich nicht euer Herr?" und sie antworteten: "Ja, wir bezeugen es." So ist jede menschliche Handlung in der Zeit zwischen dieser Ur-Anrede Gottes (dem "Gestern" der persischen Dichtung) und dem "Morgen" des Auferstehungstages eine Antwort, eine Re-Aktion auf Gottes Handlung, auf Sein Sprechen, Sein Wirken. Man liebte das Gleichnis von den Ameisen, die auf einer schönen Manuskriptseite spazierten und sich fragten, wer solche blumengleichen Muster wohl hervorgebracht haben könnte, und die lernten, daß nicht die Feder noch die Hand, der Arm oder das Gehirn so etwas tun können, wenn nicht Gott den Anstoß dazu gibt und sie leitet. So ist es mit allem, was der Mensch tut: Gott ist der erste Verursacher - wie sehr sich auch der Mensch immer wieder bemüht, sich eine Sphäre eigenen Handelns, einen Raum für Eigen-Mächtigkeit zu schaffen.
Wenn nun Gott der einzige ist, der Macht zum Handeln hat, so konnte in den Kreisen der Mystiker sehr bald die Überzeugung entstehen, daß es nichts wirklich Existierendes gibt außer Gott. Er allein hat, wie Charraz (gest. 896) es ausdrückt, "das Recht 'Ich' zu sagen". Ja, der Mensch kann im Grunde selbst das Glaubensbekenntnis nicht korrekt aussprechen, denn zu sagen: "Es gibt keine Gottheit als Gott" schließt ja noch eine Zweiheit von Sprecher und Erwähntem ein und ist daher kein echter Monotheismus.
Derartige Gedanken durchdringen die Mystik vom ausgehenden 9. Jahrhundert an und werden immer weiter entwickelt. Man kann also sagen, daß in gewissen Kreisen der exklusive Monotheismus des Islam in einen inklusiven Monotheismus verwandelt wird; das la, "es gibt nicht", ist nicht länger die Ablehnung von irgendetwas, das "neben" Gott bestehen könnte, sondern die Bezeugung, daß nichts neben Ihm bestehen kann: "Alles ist Er."
Wie kann nun überhaupt - so fragte man sich in mystischen Kreisen - eine Beziehung zwischen dem einzigen und alleinigen Gott und der von Ihm geschaffenen Welt bestehen, die ja im Koran immer wieder mit Nachdruck ausgesprochen war? Es war der aus Murcia gebürtige mystische Denker Ibn 'Arabi (1165-1240), der den großartigen Schöpfungsmythos schuf, der dann den gesamten mystischen Islam durchdrang, obgleich die außerkoranische göttliche Offenbarung, auf der dieser Mythos beruht, schon auf frühe Zeiten zurückgeht. Es heißt:
David fragte Gott: "0 Herr, warum hast Du die Welten geschaffen?"
Gott antwortete: "Ich war ein verborgener Schatz und wollte erkannt werden; deshalb schuf Ich die Welt."
Die göttlichen Namen, so sagt Ibn 'Arabi, sehnten sich in der absoluten Einsamkeit der göttlichen Einheit nach Wirkung und brachen, gleich einem allzulange zurückgehaltenen Atemhauch, in die Nicht-Existenz, die nun wie bis dahin nicht sichtbare und vom Licht getroffene Glasstückchen die Namen reflektierte und dadurch selbst eine kontingente Existenz gewann, die freilich nur so lange währt, als das kontingente Sein mit der göttlichen Lichtquelle verbunden bleibt. Die Welt ist wie ein Spiegel Gottes, und es sind die Namen, die in ihr wirken. Jeder Name hat seine Empfänger, seine Wirkungsstätten, und so ist die Absolute Einheit des deus absconditus gewahrt, während die Namen für die Vielheit der erkennbaren Manifestationen verantwortlich sind. Die Welt existiert, entstanden durch eine Art mystischen big bang.
Die göttlichen Namen nun, wie sie im Koran offenbart sind, werden in lutfiyya und qahriyya eingeteilt, d. h. solche, die mit Gottes Huld und Gnade (lutf) zusammenhängen, und solche, die sich auf Gottes Zorn und Zwangsgewalt (qahr) beziehen. Was uns gut und böse scheint, ist dem Wirken dieser Namen zu verdanken: In Beziehung zu Gott haben sie gleichen Wert, doch in Beziehung zum Menschen müssen Unterscheidungen gemacht werden, da sonst Gut und Böse hoffnungslos vermischt würden und damit das Gesetz seinen Sinn verlöre.
Maulana Rumi, der größte mystische Dichter des Islam (1207-1273), erklärt das so:
Wenn die Derwische sagen, "Alles ist gut; meinen sie, alles ist gut und vollkommen in Beziehung zu Gott, nicht in Beziehung zu uns. ( ... )
Ein König hat in seinem Gebiet Gärten, Gefängnisse und Galgen, Ehrenkleider und Reichtum, Hofstaat und Ländereien, Festfeiern und Frohsinn, Trommeln und Fahnen. In
Beziehung zum König sind alle diese Dinge gut. Ebenso wie Ehrenkleider zur Vollkommenheit seines Königtums gehören, so sind auch Galgen und Kerker und Hinrichtung Zeichen der Vollkommenheit seines Königtums. In Beziehung zu ihm sind alle diese Dinge vollkommen - aber wie wären Ehrenkleid und Galgen für sein Volk ein und dasselbe?
Beide, Gnade und Zorn, sind notwendig, denn durch den Akt der Schöpfung manifestierte sich die absolute göttliche Einheit in Zweiheit und Vielheit, der unerkennbare eine und alleinige deus absconditus manifestierte sich als deus revelatus unter den beiden komplementären Aspekten von dschalal und dschamal, der Macht und der Schönheit, des mysterium tremendum und des fascinans, und alles in der Welt untersteht einer dieser beiden Manifestationen. Das Wirken Gottes in dieser Welt gleicht dem positiven und negativen Pol, zwischen denen der elektrische Strom läuft: Weder kann Tag ohne Nacht noch Mann ohne Weib, Freude ohne Gram vorgestellt werden. Wenn der Einsichtige dieses Gewebe betrachtet, das Gott verhüllt und doch ahnen läßt, versteht er etwas von der Weisheit des unerkennbaren Schöpfers, der, wie ein mittelalterlicher persischer Meister sagt, "aus dem gleichen Eisenstück ein Hufeisen für ein Maultier und einen Spiegel für einen Herrscher machen kann". Aber Seine schöpferische Weisheit zeigt sich im allmählichen Geben: "Es gibt nichts, dessen Schatzkammern nicht bei Uns sind, und Wir senden es herab in bestimmtem Maße" (Sura 15:21). Es wird kommen, wenn es benötigt wird.
III.
Es ist verständlich, daß der Muslim unter Gottes Namen diejenigen am meisten liebt, die Ihn als gnädig, huldvoll, liebend, verzeihend schildern. Da unzählige muslimische Eigennamen aus dem Wort 'abd, "Diener, Sklave" (bei Mädchen amat, "Dienerin"), und einem der Gottesnamen gebildet werden, ist es nicht überraschend, häufig Männer mit Namen 'Abdur Rahman, "Diener des Barmherzigen", 'Abdur Rahim, "Diener des Erbarmers", 'Abdul Ghaffar, "Diener des AllVergebenden" oder 'Abdul Karim, "Diener des Gnädigen", u. ä. zu finden, denn man erhofft die Wirkungen dieser Namen auf das mit ihnen benannte Kind. (Ein nach dem Tode vieler Geschwister geborener Knabe wird daher oft 'Abdud Da 'im, "Diener des Ewig-Währenden", genannt.)
Trotz dieser Namen der Güte und Huld konnte der Koran mit seiner Emphasis auf Gott, den Richter und Gerechten, mit seinen zahlreichen Beschreibungen von Höllenstrafen und Strafgerichten den Herzen der Muslime viel Furcht einflößen. Berichte aus der Geschichte, vor allem aus der Frühzeit, zeigen, daß der Sünder immer die Gerechtigkeit Gottes fürchtet, und Schilderungen asketischer Frommer, die sich um ihrer Sünden willen die Augen ausweinten oder unsagbar harte
Bußübungen auf sich nahmen, erscheinen in der gesamten klassischen und nachklassischen Literatur. Es war eine Frau, Rabi'a von Basra (gest. 801), die in die asketische Furcht erstmals den Gedanken der reinen Gottesliebe einführte und lehrte, man solle Gott weder aus Furcht vor der Hölle noch aus Hoffnung aufs Paradies anbeten, sondern einzig und allein um Seiner unendlichen Schönheit willen. Doch blieb die Furcht vor Gottes Zorn, wie er so dramatisch im Koran geschildert wird, immer ein lebendiges Element in der Frömmigkeit, und man formulierte den Gedanken, daß Furcht und Hoffnung wie zwei Flügel seien, die den Menschen zum Ziele führen, weil sie ihn im Gleichgewicht halten. Ja, Theologen wie der große persische Sufi Yahya ibn Mu'adh (gest. 874), der "Prediger der Hoffnung", wurden von ihren Zeitgenossen getadelt, weil ihren Predigten das heilsame Element der Furcht fehlte. Und doch haben Yahyas kurze Gebete viele Nachahmer gefunden, denn schließlich betet der Muslim ja mindestens fünfmal am Tage die Fatiha, die erste Sura des Korans, die, wie jedes Kapitel des heiligen Buches, mit der Formel bismi'llahi'r-rahmani'r-rahim beginnt, "Im Namen Gottes des Allbarmherzigen des Allerbarmers und abgesehen davon sollte jedes Werk mit diesen Worten beginnen, die den Menschen immer wieder an Gottes große Barmherzigkeit erinnern. Die Hoffnung auf Seine Barmherzigkeit sollte größer sein als die Furcht vor Strafe, denn, wie der große Theologe al-Ghazzali (gest. 1111) sagt, "Der Mensch lebt zwischen Schuld und Huld, und es ziemt ihm nur das Lob und die Bitte um Vergebung."